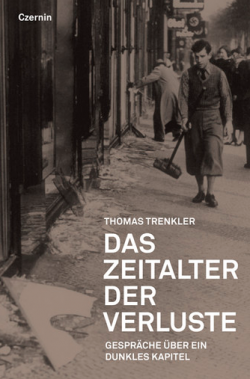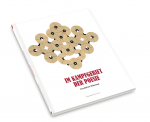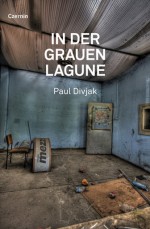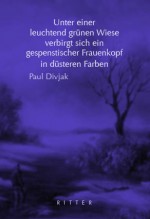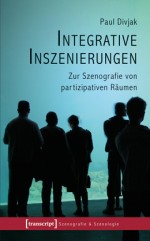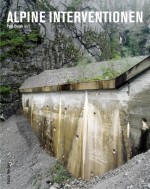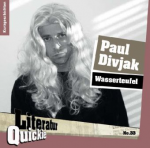[WINA - DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN | August+September 2016]
Stefan Slupetzky widmet sich als Wanderer zwischen den Welten in seinem neuen Buch der Aufzeichnung von Existenziellem.
Von Paul Divjak
Auf eine literarische Erzählzeit von zwei Tagen verdichtet Stefan Slupetzky in seinem neuen Buch „Der letzte große Trost“ eine Familiengeschichte, in die sich die Zeitgeschichte eingeschrieben hat, als gälte es, den NS-Wahnsinn pars pro toto in der „Keimzelle des Staates“ auf den Punkt zu bringen: Galt doch die Liebe der jüdischen Großmutter einst ausgerechnet dem Spross aus dem Linzer Clan, der Zyklon-B hergestellt hat. Und das Enkelkind erzählt die Geschichte.
Vor dem Hintergrund von Ermordung, Exodus und einem Landhaus in Klosterneuburg entfaltet sich die Narration als Entwicklungsroman im besten Sinne, – alles da: die (symbolische) Reise des Protagonisten, die Suche nach der Wahrheit und die Läuterung. (Maßgeblich ermöglicht durch die liebende Frau, die dem romantischen Helden auf seinem physischen und psychischen (Irr-)Weg zur Seite steht.)
Gerne folgt man als Leser den Ausführungen des Autors, begleitet die Reflektionen des Protagonisten, nimmt an der Lebensgeschichte Anteil und taucht ein in einen Text, der Erinnerung auslotet und von (inhaltlichen, formalen und stilistischen) Brüchen durchsetzt ist. Aber so funktioniert Erinnern nun mal. Die Sterne, die Gedanken: Chaos.
Es geht um so genannte „Lebensentwürfe“ und um das, was das Leben tatsächlich für einen bereithält. – Man kann sich mit den Gegebenheiten und Umständen arrangieren, man kann ihnen aber auch etwas entgegenhalten. Und genau das versucht der Protagonist.
Fakt oder Fiktion?
Die an den Autor immer wieder herangetragene Frage nach der Authentizität der Story, dem Grenzverlauf von Fakt und Fiktion, scheint bisweilen vom Eigentlichen abzulenken. Der Roman setzt sich vor der Hintergrundschablone der Familienhistorie mit den verschiedenen Rollen des Protagonisten als Enkel, Sohn, Bruder, Ehemann – und Vater auseinander.
Slupetzky nimmt uns mit in eine Zeit, da der Tod für das Kind noch nicht existierte, obwohl er doch in der Familie allgegenwärtig war, den Protagonisten unausgesprochen umgab.
Es geht um den Umgang mit der Zeit, der Leere und der Angst, um Sinnfragen und ums Abschiednehmen: von den Eltern und von sich selbst als Kind und Jugendlichem, von Ideen und Vorstellungen, Weltbildern und einstigen Träumen und Perspektiven. Was sich einschreibt ist das Leben, die Liebe und das Spannungsfeld von Geborgenheit, Sicherheit und Zuhause auf der einen Seite, und Freiheit, Unsicherheit, emotionalem Chaos auf der anderen.
Gleichsam wie in Camus „Der erste Mensch“, in dem der Sohn vor dem Grab des Vaters realisiert, dass er bereits älter ist, als es der Vater je wurde, birgt der Plot für Daniel, den Titelhelden, Einsichten in Sachen Liebe und Endlichkeit. Und es ist wohl kein Zufall, dass der Autor seine Figur in einer Schlüsselszene in den Keller schickt, um ihn im Kokoon des dunklen Untergeschosses des einstigen Familiensitzes gleichsam symbolisch in die Tiefen des Unterbewussten eintauchen und nach der Vergangenheit forschen zu lassen.
Resonanzräume für Kindheitswahrnehmungen
Slupetzkys berührendste Passagen sind wohl jene, in denen es ihm gelingt, atmosphärische Resonanzräume für Kindheitswahrnehmungen zu gestalten, sinnliche Erfahrungen wiederaufleben zu lassen. Die Beschreibungen der Begegnungen mit alltäglichen Dingen und der Präsenz des behutsam-fördernden Vaters gehören sicherlich zu den hell leuchtenden Momenten des Romans.
Manche dieser Passagen lassen an Kafkas „Brief an den Vater“ (die Auseinandersetzung mit dem Judentum), andere an die Roths denken: an Joseph Roth („Zipper und sein Vater“, 1928) einerseits und Philip Roth („Mein Leben als Sohn“, 1992) andererseits. Setzt sich Letzterer mit der Krankheit des Vaters und dem eigenen Älterwerden auseinander, so lässt Ersterer seinen vaterlosen Ich-Erzähler angesichts des Todes seines Ersatzvaters sagen: „Wir vergeben nicht, wir vergessen. Oder besser: wir vergessen nicht, wir sehen gar nicht. Wir geben nicht acht. Es ist uns gleichgültig.“
Stefan Slupetzkys Protagonist aber will nicht vergessen, er möchte hinschauen. Er gibt acht. Es ist ihm nicht gleichgültig: „Der letzte große Trost“ ist vom Erinnern geprägt, vom Versuch, sich der (eigenen) Vergangenheit zu vergewissern, sich selbst einzubetten in ein größeres Ganzes. Davon, die Erinnerung an geliebte Menschen wach zu halten.
Und loszulassen.