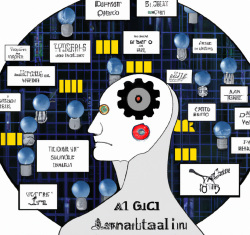WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 11_2012 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
„In seinen tausend Honigwaben speichert der Raum verdichtete Zeit.“
Gaston Bachelard
Der Concierge begrüßt einen freundlich aus seiner verglasten Loge; wir befinden uns nicht in einem Appartementhaus in New York, sondern mitten im Stadtzentrum von Wien, in der Herrengasse.
Beim ältesten Hochhaus der Stadt, errichtet vom Architektenteam Theiss & Jaksch Anfang der 1930er-Jahre, handelt es sich um eine stadtplanerische Meisterleistung, sieht man ihm doch aufgrund seiner abgestuften Terrassenbauweise die Höhe von 53 Metern von den engen Straßen und Gassen der Innenstadt aus nicht an. Nichtwissende Passanten würdigen die Fassade keines weiteren Blicks. Errichtet von der Gemeinde, waren die Mieten in dem Nobelkomplex hoch, folglich zog das Haus nicht zuletzt Prominenz als Bewohner an. Curd Jürgens hat hier residiert, Gunther Philipp, Oskar Werner und der Schriftsteller Lew Abramowitsch Nussim- baum (alias Essad Bey). Und auch heute noch gilt eine Bleibe in dem Meisterstück der Moderne als Prestige- gewinn, und so findet man hier Vertreter aus Medien und Kultur Tür an Tür neben älteren, alleinstehenden Damen, Mieterinnen der ersten Stunde.
Die Türen des Aufzugs schließen, die langsame Fahrt führt in den 13. Stock. Top 79 steht einladend offen. Die Abendsonne, die soeben hinter der Minoritenkirche untergeht, taucht das kleine Einzimmer- Apartment, in dem sich eine holzverschalte Kochnische befindet, in weiches, orangefarbenes Licht.
Der Neue Wiener Kunstverein, initiiert von einer polnischen Kuratorin, hat hier ein temporäres Zuhause gefunden. Die Künstler der Eröffnungsausstellung thematisieren den Ort, sie zeigen historische Postkarten und eine Fotoinstallation. Ein alter Diaprojektor projiziert eine Strandlandschaft durch die geöffnete Balkontüre hinaus ins Freilichtpanorama. Im Hintergrund: der Kahlenberg. Das Bild verliert sich, legt sich als unsichtbare Ebene über die Stadt.
Eine Wohnung wie dieses Zimmer mit Aussicht wurde einst als Junggesellenappartement gehandelt. Im 1938 in Prag erschienen und kurze Zeit später als „unerwünscht“ geltenden Roman Morgen ist alles besser von Annemarie Selinko wohnt die emanzipierte Protagonistin in einer solchen Luxus-Garçonière. Sie trifft im Aufzug auf einen Engländer, verliebt sich in ihn und schläft kurzerhand mit ihm. Eine moderne Frau in einem modernen Bau.
Die Rückseite des Daches der Burgtheaters wirkt von hier aus wie der Giebel einer Bahnhofshalle Otto Wagners, die Dachkonstruktion von Hiesmayrs Juridicum wie ein vor Ort gestrandetes Schiff. Am Hof schreitet der Umbau des einstigen Hofkriegsratsgebäudes und späteren Bankensitzes zum Hotel voran. Der Großbrand im letzten Jahr ist dem repräsentativen Bau nicht mehr anzusehen.
Ein Blickwinkel von 180 Grad. Nähe und Distanz. Aus dieser ungewohnten Perspektive erfährt das scheinbar Vertraute eine neue Dimension. Der Blick auf die Stadt verändert sich. Die Winkel, uneinsichtigen Ecken, verborgenen Straßenfluchten dieses engen urbanen Geflechts scheinen mit einem Mal auf das Verdrängte der Geschichte, die sich in diese historische Kulisse eingeschrieben hat, zu verweisen.
Allmählich wird es dunkel. Lichtermeer.
(Die Autorin Annemarie Selinko wurde 1914 als Tochter eines Textilhändlers in Wien geboren. Sie war im dänischen Widerstand aktiv und wurde zwischenzeitlich von der Gestapo inhaftiert. Sie starb 1986 in Kopenhagen und ist heute trotz schriftstellerischer Welterfolge nahezu vergessen. Ihr letztes Werk Desirée hat sie ihrer Schwester Liselotte gewidmet, die in Auschwitz ermordet worden ist.)
[wına | November 2012]

 WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 5_2017 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 5_2017 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK