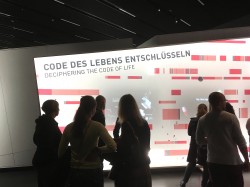 WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 1_2019 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 1_2019 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
„Buchen sie ein Zeitfenster!“ –
Willkommen in der Kultur der Masse,
des Spektakels und der Effizienz.
Haben sie ein Zeitfenster? – Sie brauchen ein Zeitfenster-Ticket“, sagt der rothaarige Museumsmitarbeiter mit der Kippa. Über Umwege stehe ich dann kurz darauf in James Turells Installation Ganzfeld „Aural‘“ im Jüdischen Museum in Berlin. Einen „gleichsam überirdischen Raum, der die Regeln der weltlichen Erfahrung außer Kraft zu setzen scheint“ hätte Turell, der „Bildhauer des Lichts“, geschaffen, heißt es auf dem Flyer, der mit in die Hand gedrückt wurde.
Was in der zeitgenössischen Kunst gemeinhin als Immersion gepriesen wird, entpuppt sich im Rahmen der Installation als physisch klar begrenzte räumliche Situation. Nachdem man die Schuhe ausgezogen und seine Füße mit blauen Einwegplastiküberzügen verhüllt hat, steigt man die Treppen hoch und betritt durch ein Portal eine leere Guckkastenbühne.
Der Boden, die Wände, die Decke: allesamt in monochromes Licht getaucht, das sanft die Farbe wechselt, bisweilen nervös zuckt. Setzt man seine Schritte allerdings zu nahe an die Stirnwand, ist ein deutlicher Piepston zu vernehmen, der zu sagen scheint: Bewegen Sie sich gefälligst in den Ihnen zugedachten Sektoren. Im Rahmen des installativen Reizentzuges werden wir also klar in unsere Schranken verwiesen. Art-Anderswelt ist so anders nicht. Die BesucherInnen sind angehalten, sich an den abgesteckten Rahmen der Inszenierung zu halten. Die optimale Entfaltung der Kunst bedeutet die Einschränkung unserer Bewegungsfreiheit.
„Licht ist zentrales Symbol im Judentum“, ist auf einem Vermittlungswandtext zu lesen. Und die Arbeiten Turells könnten „als eine der spektakulärsten künstlerischen Interpretationen der Erschaffung des Lichts angesehen werden“.
Während das Publikum in der Installation das ihnen gewährte Zeitkontingent im künstlichen Licht erschöpft, genießen andere BesucherInnen die letzten Sonnenstrahlen im Museumsgarten. Der Countdown läuft; der lange graue Winter Berlins steht vor der Türe.
Auch in Wien setzt man auf Tickets inklusive Zeitfenster, die exakte Taktung der Blockbuster-Besucherströme, wie die aktuelle Bruegel-Megashow im Kunsthistorischen Museum zeigt. (Im Rahmen des von Wes „Hollywood!“ Anderson und Juman Malouf inszenierten Best-Of Spitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasures finden sich hingegen noch herkömmliche Eintrittsschlupflöcher in den besagten Museumstanker.)
Fungierten die Museen einst selbst als eine Art Zeitfenster, als Ort der Geschichte(n) der möglichen Kontemplation und Reflexion, erzählten die Objekte und ihre Befragung von Vergangenheit und Gegenwart, so deutet die Verwendung des Begriffs „Zeitfenster“, ursprünglich in Technik und Betriebswirtschaft beheimatet, im musealen Kontext von Abwicklung und Verwaltung der (Massen-)Kultur und von der Praxis des gesellschaftlichen Umgangs mit Zeit und Ressourcen.
Wir absolvieren Termine, haken To-do-Listen ab, arbeiten auf Deadlines hin, im Sinne von Leistung und Produktivität gilt es, agil zu performen, Sprints hinzulegen und Showstopper zu vermeiden. – Nur logisch, dass heute selbst der Museumsbesuch über Zeitfenster organisiert ist.
Rund um die Uhr beschäftigt, bestimmen Leistungs-, Zeitdruck und Stress unseren Alltag; Arbeit und Freizeit. Und vor dem Hintergrund von lautem medialen Dauergetöse und um unsere Aufmerksamkeit heischenden Ablenkungen, von unsäglichen politischen Überzeugungen und Hassreden, zweifelhaften ökonomischen Interessen und menschenverachtendem Handeln öffnen sich immer weitere, immer noch tiefere Abgründe, während sich essentielle, die Weltgemeinschaft betreffende Zeitfenster zu schließen drohen.
[wina 1_2019]













