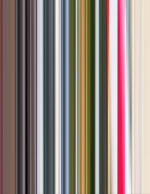WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 07+08_2018 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 07+08_2018 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
„Vienna never left my heart“ (Ruth Weiss)
Wir sitzen in einem Innenstadtcafé, mein Freund, der Literat, und ich. Am Nebentisch gibt der französische Soziologe und Philosoph Didier Eribon, der mit seinen Memoiren Rückkehr nach Reims, Roman und soziologische Studie gleichermaßen, aktuell länderübergreifend Erfolge feiert, eben ein Interview. („Was schwierig war, war nicht die Homosexualität, sondern vielmehr die Tatsache, aus dem Arbeitermilieu zu kommen“, sagt er.)
Eribon ist mit Mitte 60, im besten Alter, die Aufmerksamkeit und Anerkennung, die ihm zukommt, die Aufnahme seines Werks in den Gegenwartskanon zu genießen.
„Was liest du gerade?“, fragt mich mein Freund.
„Irvin Yaloms Memoiren Wie man wird, was man ist“, antworte ich. „Sie beeindrucken in ihrer Klarheit, Unverstelltheit.“
Wann hat man zuletzt einen über 80-Jährigen in solcher Offenheit über das Abnehmen von körperlichen und geistigen Kräften reflektieren, das eigene Leben, die eigene Arbeit, individuelle und kulturelle Errungenschaften und Versäumnisse mit derart analytischer Einfachheit hinterfragen und darlegen gesehen?
Wir sprechen über das Ausloten von Wahrnehmungsvertiefungen, das kreative Schaffen über die Jahre und im hohen Alter sowie ausbleibende Öffentlichkeit: Odysseen von phänomenologischen Erkundungen und versuchten Weltaneignungen versanden oftmals unbemerkt.
Mein Freund lenkt meine Aufmerksamkeit auf eine alte Dame, mit der er eben ein Projekt vorbereitet: Ruth Weiss, geboren 1928 in Berlin, aufgewachsen in Berlin und Wien, emigriert 1938, Beat-Poetin der ersten Stunde. Sie, die zeitlebens die Avantgarde gelebt hat, erfährt nun im Alter vermehrte Resonanz, gleichsam ein literarisches Pendant zur späten Luise-Bourgeois- und Maria-Lassnig-Rezeption.
the bells are ringing/no more procastination …
Ein Youtube-Video zeigt Ruth Weiss, agil mit grün gefärbten Haaren und Fingernägeln, auf der Bühne der San Francisco Public Library:
the mask we are/the mirror reflects/reveals the real/ the past we wear/swimming in clear soup …
Begleitet werden ihre Worte von Hal Davis, der rhythmisch auf einem ausgehölten Stamm trommelt.
Momentaufnahmen des Gegenwärtigen, Blitzlichter des Vergangenen; Liebe, Verlust und Schmerz. In Weiss Texten finden sich Alltag und Geschichte(n). Als Chroniken der Absurdität der Conditio humana, getragen von Tiefgang und Humor, sind sie Zeugen einer Haltung, von Poesie als Lebensweg. Mit tiefer Stimme trägt Weiss das Poem From me to you vor:
if you have love for me/say not: „i love you“/and that will keep me free/if i have love for you/i shall not say: „i love you“/and that will keep you free …
Die durchgehende Kleinschreibung in ihrem Werk, von Anfang an, sei eine Art der persönlichen Rebellion gegen die deutsche Sprache, sagt die Poetin, einer Sprache, die sie natürlich immer noch spreche und liebe. In dem Gedicht Hall in Tyrol beschreibt Weiss die Begegnung zwischen den Geschlechtern unter veränderten Vorzeichen:
she is king of the mountain/he is queen of the castle.
Kopfüber auf ihren Kronen, versuchen die beiden lyrischen Figuren, auf dem Marktplatz das Gleichgewicht zwischen Tränen und Lachen zu halten. Mit bedächtiger Stimmer liest sie die finalen Zeilen:
… with a sprinkle of salt/they are the voice of the poem/ they are the silence between the lines …
Ruth Weiss nimmt ihre Brille ab. Sie sagt leise „Ok“, blickt mit ihren wachen Augen, die vieles wahrgenommen haben, in die Kamera, neigt den Kopf fragend und lächelt. Mein Freund und ich schauen einander an, und wir sind uns sicher: Die Gegenwart braucht Poesie.
[wina 7+8_2018]