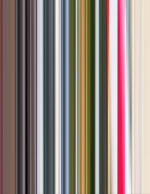WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 05_2023 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
„Wir alle folgen einem Ruf. Aber dieser Ruf verändert sich immer wieder.“ Isolde Charim
Der vergangene Winter – das lässt sich, um Paul Watzlawick zu paraphrasieren, nicht nicht wahrnehmen – war schlichtweg zu warm. Auf der positiven Seite ist die Reduktion der (privaten) Heizkosten angesichts von Höchstpreisen und Rekordgewinnen bei Energieanbietern zu verbuchen. Auf der negativen Seite ist anzumerken, dass Schnee und Eis vielfach ausgeblieben sind. Ein Umstand, der nicht nur manchen Traum vom Après Ski zum Schmelzen gebracht hat, sondern der auch maßgeblich dafür mitverantwortlich ist, dass bereits im Frühjahr das Wasser mancherorts knapp wird oder gar gänzlich fehlt.
Hinsichtlich aktueller, miteinander in Wechselwirkung stehender Umweltkrisen ist für uns vieles nicht (mehr) direkt Greifbares zum ständigen thematischen Begleiter geworden; kurzfristig erregt eine polarisierende Horrormeldung unsere Aufmerksamkeit, versetzt uns in Angst und Schrecken (das bringt gewünschte Reichweite), lässt uns affektiv-reaktive Worthülsen absondern, bevor wir uns wieder dem ersehnten Rückzug in unseren Alltag widmen.
Mitunter scheinen wir uns in der beruhigenden Annahme zu wiegen, ein Problem sei gelöst, weil wir darüber gesprochen haben. Das auf uns wuchtig Einprasselnde und potenziell Überfordernde (handelt es sich um eine Tatsache oder vielmehr um Propaganda, um Fake?) verschärft sich in seiner medialen Reaktivierung von Mal zu Mal, es übersteigt unsere Kapazitäten. Die multiplen globalen Missstände und überreizenden Informationszumutungen sind für einen fühlenden, empathischen Menschen einfach nicht auszuhalten.
Die Ohnmacht wächst, das Verdrängen liegt nahe; kognitive Dissonanz wird zum Dauerzustand einer Gesellschaft. Und die Halbwertszeit des Vergessens wird noch einmal auf Beschleunigungsmodus gestellt: „Umwelttrauer? Nein, danke!“
Das große Rauschen der gespenstischen Szenarien tobt, in vermeintlicher Distanz zu unserer Konsum- und Wohlstandsblase, unmittelbar vor unseren Türen. Klima- und Umwelthorrormeldungen, dazu Krieg in Europa, bewaffnete Konflikte, weltweit, Flüchtlingselend, unmenschliches Agitieren, Hetze gegen Minderheiten – die traurige Liste ist lang, die Komplexitäten sind vielschichtig.
Bisweilen und immer öfter aber finden sich Menschen zusammen, beteiligen sich an gemeinschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Initiativen und Aktionen, um auf lokaler, überregionaler und globaler Ebene an neuen, an alternativen Modellen zu arbeiten, um eine für alle lebenswerte Zukunft zu ermöglichen und politischen Entscheidungsträger:innen dringend notwendige Schritten nahezulegen, sie statt kurzfristigem Wahlerfolgsdenken für substantielle, längerfristige Maßnahmen zu gewinnen. Dafür braucht es freilich enormes Engagement und Durchhaltevermögen, ist doch gegenwärtig eine Art Backlash in Sachen Transformationsprozess der Gesellschaft zu beobachten: Gute Absichten und Visionen werden wieder hintangestellt, der Fokus wird vielfach wieder weiter auf überkommene Haltungen und Wirtschaftsmodelle und (kurzfristige) Gewinnmaximierung gelegt – und „Nachhaltigkeit“ ist dabei nichts als ein hohles Marketingversprechen.
Von Tag zu Tag scheinen wir uns als Narzisst:innen und maßlose Hedonist:innen mehr und mehr in der Hoffnung zu wiegen, dass die Technologie der Zukunft für uns als Spezies ohnehin alles wieder ins Lot bringen werde. Auf planetarem Level, versteht sich. Vordergründig frönen wir weiter dem Hyperkonsum, ganz so wie bisher – aber wir trennen unseren Müll und haben uns als Zweitauto selbstverständlich einen Elektrowagen zugelegt.
Im Sommer lädt jetzt übrigens auch der St. Moritzersee zum Schwimmen ein – bisher war der auf 1.768 Metern über dem Meer liegende Gebirgssee doch etwas zu kalt für den erfrischenden Ferienbadespaß.
An palmengesäumten, südostasiatischen Traumstränden wiederum sorgt, mit freiem Auge zunächst gar nicht als solches erkennbar, tonnenweise mikrofeines Plastikgranulat im Sand, an den Muscheln, an Schwemmholz und angespültem Müll für farbenfrohe Urlaubsstimmung.
[wina - 05–2023]