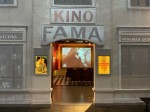WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 10_2017 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 10_2017 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
„I’m walking through deep water / I have no time to lose …“ Arthur Cave (2000-2015)
Ganz allgemein ist vom Verdrängen des Todes in unserer Kultur die Rede, dabei haben wir es auf der einen Seite mit einer Privatisierung des Sterbens und der professionalisierten, institutionalisierten Verwaltung des Todes und auf der anderen mit einer dauerhaften Präsenz des mediatisierten Sterbens zu tun.
Die Meldungen über Krieg, Terror, menschengemachte und naturbedingte Katastrophen, Flüchtlingselend und Hungersnöte gehören zum Medienalltag; der beständige Todes-Nachrichtenfluss kratzt an unseren Wahrnehmungsfiltern.
Der Tod ist allgegenwärtig in Nachrichten, Filmen, Games und Co.; die Unterhaltungsindustrie ist gerade zu besessen von Inszenierungen der Gewalt, des Kämpfens, Tötens und Sterbens. Und uns KonsumentInnen sind diese Repräsentationen des Todes wohl gleichsam Nervenkitzel und willkommener Bann, ganz so als ließe sich, – gleich einem techno-schamanistischen Schutzzauber –, der eigenen Sterblichkeit – zumindest eine Zeitlang – ein Schnippchen schlagen, die Todesangst ein wenig besänftigen.
Die Verhandlung der Todesfälle von Personen des öffentlichen Interesses, im Rahmen derer Fantum, Weltschmerz und individuelle Todesangst im Web 2.0 in bisher nicht gekannten Ausmaßen an Projektionen auf eine populäre Persona rückgebunden werden, erzählt von der popkulturell durchtränkten Handhabe im Umgang mit dem factum brutum in unserer Medienkultur. (In der freilich auch der einstmals bewährte Faktor des „Einen-Namen-Habens“ nicht ein dauerhaft Im-kollektivierten-Gedächtnis-Verankertsein garantiert und vor dem ewigen Vergessenwerden schützt.)
Prominente Todesfälle beschäftigen die Massen. Das Sterben von VIPs generiert im Netz resonanzfähige Kulturmuster von Betroffenheitsaffekten und Trauereffekten. So ist etwa das Jahr 2016 als Pop-Sterbensjahr, in dem u.a. Prince, David Bowie und George Michael, – wie eine Redensart seit dem 17. Jahrhundert besagt – das Zeitliche gesegnet haben, in die Historie des Netzzeitalters eingegangen und hat weitere Streiflichter auf Memebildungen, die R.I.P-Kultur und Konsens-Trauerbekundung im kulturellen Resonanzfeld geworfen.
Fehlen die Worte, ist die in der christlichen Bestattungskultur gerne verwendete, auch im Hebräischen und Aramäischen auftauchende Abkürzung für Requiescat in Pace rasch getippt: R.I.P. Das als Grabinschrift und auf Totenzetteln verwendete Epitaph, das für den Verstorbenen ein ewiges Ruhen in Frieden erbittet, führt heute abgekoppelt von Glauben und religiösen Überzeugungen ein digitales Eigenleben als populäres thanatosspezifisches Netzjargonkürzel.
Anders der Einbruch des Realen im persönlichen Umfeld, die Plötzlichkeit mit der ein Lebensende sich in den Newsfeed, die eigene Timeline einschreibt. Das Unfassbare im Nachrichtenstrom der Unterhaltung und Distraktion lassen einen gerade Verstorbenen in seiner Abwesenheit schmerzhaft anwesend sein. Die Präsenz nimmt im Umfeld von mehr oder weniger banalen Statusmeldungen einen ganz besonderen Stellenwert ein: Sie konfrontiert unmittelbar mit dem Nichts, der gähnenden Leere angesichts des Todes (angesichts dessen alles andere lächerlich ist, wie Thomas Bernhard einmal festgestellt hat).
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Säkularisierung prägen Irritation und Unsicherheit den Umgang mit dem Tod. Es entstehen aber auch neue Mischformen von On- und Offline-Kommunikation und -Interaktion hinsichtlich Sepulkral- und Memorialkultur; die Gesellschaft befindet sich auch in Bezug auf den Umgang mit dem Tod fortwährend im Wandel: In der digitalen Diaspora ermöglicht das WWW neue Möglichkeiten des sozialen Zusammenfindens, des (virtuellen) Zusammenrückens in einer Lebensweltordnung der sozialen Zerklüftung, des drohenden Auseinanderdriftens von Gemeinschaft.
[wina - 10.2017]