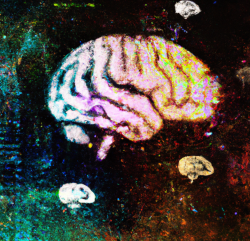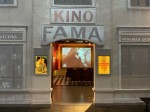WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 05_2021 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
»Wo sind plötzlich alle hin?
Alles weicht zurück und verschwindet
Nur die Worte schweben noch
Wohin gehen wir von hier aus, wohin?«
Avi Bellieli (Titellied „Shtisel“)
In Zeiten, in denen die Kinos seit Monaten geschlossen sind, wird mitunter der Bildschirm zur Leinwand. Die Spielfreude der Akteur*innen von Shtisel überträgt sich, die Figuren nehmen uns mit, wir tauchen ein in die Weltvermittlung sozialer Strukturen, historisch geformter Riten und Traditionen. Identitäten werden in der Gemeinschaft geformt und stehen doch immer wieder aufs Neue in Frage, sie geben Halt und lassen taumeln. Im Raster des Gesetzes der Gemeinde erfährt der/die Einzelne ambivalente Gefühle. Die humorvolle Zeichnung der eng abgesteckten Lebenswelten bildet den Rahmen, innerhalb dessen sich die Familiendarstellung bewegt und Sinnfragen gestellt werden.
Popkultur wird bisweilen zum Kult. Im Pop resakralisiere sich bis zu einem gewissen Grad der profane Alltag der westlichen Welt, stellt Caspar Battegay in Judentum und Popkultur fest. Im Falle von Shtisel verwandelt sich gleichermaßen die Inszenierung des Sakralen im Alltag in einen Streaming-Religionsersatz. Die Netflix-Gemeinde feiert die entschleunigte Erzählung, die Familiensaga begeistert in einer aus den Fugen geratenen Welt mit allegorischen Rauchzeichen aus einem scheinbar aus der Zeit gefallenen Paralleluniversum.
Vor dem Hintergrund der Ufer- und Haltlosigkeit der westlichen Gegenwart und des Unbehagens sowie der Ungewissheit angesichts aktueller Schieflagen und multikomplexer Drohszenarien ist der von strikten Vorschriften geprägte Familiensoapalltag aus Jerusalem als quasi-authentische Darstellung charedischer Lebenswelt Faszinosum mit Binge-Watching-Potenzial. Selten zuvor war das Ultraorthodoxe dermaßen hipp.
Detailreiche Stimmungsbilder, maßgeblich getragen von Blicken, Gesten und vom Klang des Hebräischen und Jiddischen entfalten einen Sog, dem sich zu entziehen schwerfällt; Episode für Episode, von Kapitel zu Kapitel. Eine Serie wie ein historischer Roman, der vom Hier und Jetzt des*der Einzelnen und seinem*ihren Eingebettetsein in die Gemeinschaft erzählt: Die Protagonist*innen folgen Identifikations(an)geboten – und sie hadern mit diesen.
Im Mikrokosmus von Setting und Narration spiegeln sich innere und äußere Widersprüche in Bezug auf eine Welt, „in der sich der Mensch allein mit sich selbst konfrontiert findet, in den Lüften wie auch am Grund der Ozeane“ (Jean-Luc Nancy).
Die Menschheit befindet sich in einer pandemischen Gegenwart, der Planet ist geprägt von kognitiven Dissonanzen hinsichtlich der Ausweglosigkeit multipler Krisen. Staatliche Territorien sind eng abgesteckt, Grenzen dichtgemacht; die Bewegungsfreiheit ist aktuell eingeschränkt, das Leben spielt sich hinter geschlossenen Türen ab. Die Zukunft wird von radikalen Veränderungen bestimmt sein.
Es ist wohl kein Zufall, dass eine Serie wie Shtisel, die mit ihren von äußeren Einflüssen erschütterten Identitäten ebenso facettenreiche wie archetypische Porträts des Menschen zeichnet, aktuell derart große Resonanz hervorruft. – „Wohin gehen wir von hier aus, wohin …?“
[wina - 05_2021]