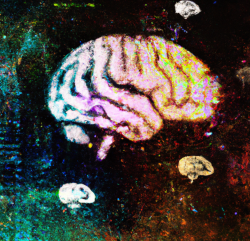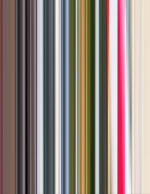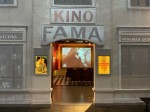WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 03_2018 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 03_2018 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
„Der Nationalismus ist eine Ideologie, die einen Feind braucht; er kann ohne ein anderes, gegen das er sich stellt, nicht existieren, wer oder was auch immer dieses andere sein mag.“ Slavenka Drakulic
Die mediale Landschaft wird aktuell von politischer Seite mit groben Werkzeugen bearbeitet, radikalisierte Rückgriffe und sprachliche Übergriffe garantieren Aufmerksamkeitseffekte und das erwünschte Agenda-Setting.
Was aktuell Form angenommen hat, ist ein offener Kampf um die Konstruktion der Deutungshoheit. Rechtspopulistische und extreme Schachzüge, die auf unsere bewusste und unbewusste Sicht auf die Wirklichkeit einwirken, versuchen, Alltag und Staat nach einem bestimmten Wertemuster zu organisieren. Und es ist keine Frage: Das ihnen zugrundeliegende Modell ist ein ewig gestriges.
Wohin wir auch schauen und hören: Allerorts findet das politische Ausloten von Begriffssetzungen statt, wird an der Veränderung des wieder Aussprechbaren gearbeitet, wird perfides, krudes oder schlichtweg dumpfes Denken etabliert. Überall kommen Nationalismus und Separatismus zur Anwendung, werden Ablenkungsmanöver, Finten und Beweisführungen durch mediale Inszenierungen platziert. Die Wirkungen sind nachhaltig katastrophal, haben diese Aktionen doch normierenden Charakter.
Mit jedem gezündeten Wort, mit jeder weiteren Platzierung historischer Referenzen (beziehungsweise der Leugnung eben dieser), sickert die nächste Dosis Überzeugung in den Wahrnehmungsbereich der MedienkonsumentInnen.
Stereotype und Vorurteile sowie Rückbezüge auf menschenverachtende Weltbilder und auf vermeintlich überschaubare(re) Gesellschaftssysteme als Lösungsversuche für die komplexe, das Individuum überfordernde Realität, verfremden vermeintliche Gegebenheiten und tragen zur weiteren Identitätskonstruktion und Isolierung der „anderen“ bei.
Durch Wirklichkeitsfilter betrachtet wird Grobes entfesselt, Vernichtendes konstruiert. Die Produktion von Asymmetrien und Ungleichheitseffekten wird aktuell ideologischerweise groß geschrieben.
Und das Prinzip Hoffnung wird durch das Prinzip Verachtung ersetzt.
Zunehmend wird mit einer „Schauderwirklichkeit“ (Paul Watzlawick), mit negativen Überzeugungen hantiert, das verbale Feuer eröffnet. Krisen werden ausgerufen, Schuldige und Feinde benannt, vermeintliche Lösungen gutgeheißen: Es dröhnt der Ruf nach Ordnung, systematischer Typisierung und Ausgrenzung, während der Staatsapparat sukzessive umgefärbt wird: Dasselbe alte Proporzdenken in Blau wird als politische Alternative verkauft. Und „die Nachfolger der Vorläufer der Nazis“ (Doron Rabinovici) geben zunehmend den Ton an.
Der Wunsch, eine durchschaubare, eine übersichtliche Welt zu schaffen, mündete bereits einmal in der katastrophalen Überzeugtheit, alles Ambivalente vernichten, das Uneindeutige, die Fremden, die Andersartigen aus dem Blickfeld, als Unerwünschtes aus der Welt schaffen zu müssen.
Was für ein Anachronismus, der europaweit wiedererstarkende Nationalismus! Statt gemeinsam eine moögliche bessere Zukunft für alle zu gestalten, finden wir uns heute in einer prekären, radikalisierten technokratischen Kontrollgesellschaft wieder, in der das Flüchtige und jede Andersheit als Bedrohung wahrgenommen werden. – Die Unkontrolliertheit des Lebens und der Welt aber lässt sich nicht bannen.
(Einige Gedanken dieses Textes werden auch in Paul Divjaks kürzlich erschienenem Essay „Vorbereitungen auf die Gegenwart“ (Edition Atelier) aufgegriffen: ein Plädoyer für eine neues, respektvolles, ein „unbändiges Denken“, das zur Gestaltung von positiven gesellschaftlichen Veränderungsprozessen beiträgt.)
[wina - 03.2018]