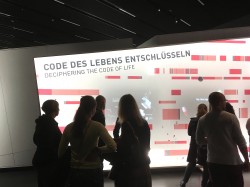WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 11_2021 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
“Die Zukunft ist mir der Lebensweise der Viren näher verwandt als mit der des Menschen oder seiner Denkmäler.” Emanuele Coccia
Das offizielle Zürich ist stolz, wurde doch jüngst der Erweiterungsbau des Kunsthaus Zürich, der jahrelang für Diskussionsstoff gesorgt hatte, feierlich eröffnet. Auf dem Programm standen Previews für die Financiers und VIPs, exklusive Dinners für Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Kultur – und ein Open-House-Weekend für die Bevölkerung. Nach der obligaten Covid-Zertifikatsüberprüfung samt Identitätscheck darf das massive Portal, das anmutet wie das repräsentative Entree einer Schweizer Großbank, betreten werden. Im riesenhaften Foyer herrscht lebhaftes Getümmel – ganz großer Luxusbahnhof, Eventcharakter inklusive. Menschen drängen sich maskenlos dicht aneinander durch die hohe Eingangshalle, das massive Treppenhaus, die Ausstellungsräumlichkeiten, die endlosen Flure, vorbei an den Schätzen der Kunstgeschichte und durch die aktuelle Ausstellung Earth Beats, eine Themenschau zum Wandel des Bildes der Natur in der Kunst.
Auf den lichtdurchfluteten Ebenen des neuen Museumsmonolithen wimmelt es geschäftig; Familien mit Kindern, unterschiedliche Paare verschiedenen Alters, Damen und Herren im Sonntagsoutfit – Menschen von nah und fern. Die Besucher:innen schauen sich um, verharren angesichts der Dimensionen und Impressionen, führen angeregte Diskussionen. Einmal mehr wäre das MoMa Vorbild gewesen, hätte die museale Schablone gebildet, hört man hier, und dort wird festgestellt, dass alte, gelungen adaptierte Industriebauten à la Tate Modern einfach doch noch einmal andere Dimensionen hätten und eine ganz spezielle Aura verströmen würden. Dauerhafter Gratiseintritt für alle, wie im Museum an der Themse, das wäre wünschenswert gewesen, stellen zwei elegante Damen fest. Die Chipperfield-Architektur und die verwendeten erlesenen Materialien werden unter die Lupe genommen und genauer reflektiert: Marmor- und Eichenböden, Messingverkleidungen und -handläufe und die obligaten Rohbetonwände.
Auch das dauerhafte Aufeinandertreffen der bedeutenden Sammlung des Ehepaars Merzbacher und der Sammlung Bührle im nunmehr größten Kunstmuseum der Schweiz ist ein Thema. Auf der einen Seite: die Werke aus dem Besitz von Werner Merzbacher, der mit einem Kindertransport in die Schweiz kam und dessen Eltern im Holocaust ermordet wurden. Auf der anderen: die aus den Beständen von Emil Bührle (1890–1956), einem Waffenindustriellen mit Naziverstrickung, dessen Impressionisten-Highlights nun laut Kunsthaus „einen Quantensprung im Bereich der Sammlung“ darstellen würden. – Und das mit einem Spin in Sachen Provenienzfragwürdigkeit.Zu Bührle finden sich in einem Vermittlungsraum des neuen Hauses Wandtexte mit dem Lebenslauf in Kapiteln. Hier heißt es unter anderem: „Gegen Ende des Krieges verdichten sich die Nachrichten vom deutschen Kunstraub im besetzten Frankreich, und Emil Bührle wird bei Käufen vorsichtiger.“ Der heute 93-jährige Werner Merzbacher hingegen wird gerne mit den lapidaren Worten „Die Bilder können ja nichts dafür“ zitiert.
Die einzigartige Schönheit der Bilder hat ihren Preis. Er erzählt vom Spannungsfeld von Kunst, Politik und Wirtschaft, in das sich Leben und Überleben, Krieg, Vernichtung, Tod und Profit einschreiben.
Hinter der schimmernden, hochpolierten Fassade, der pompösen Inszenierung von kunst- und kulturbasierendem Humanismus, dem zivilisierten Schein der Ästhetisierung von Alltag durch Vermögen sowie dem Wunsch nach einem gewaltigen Vermächtnis und dem Standortbegehren nach Weltformat, zeichnet sich unter einem gemeinsamen Dach das Drama der Geschichte ab.
Das der Kunsthistorie gewidmete neue Schatzhaus scheint zu einem impressiven Symbol für den ambivalenten Umgang mit der NS-Zeit – gerade auch der Schweiz – geworden zu sein: Es ist gleichsam Kathedrale der Kunst wie monumentaler Sarkophag ihrer kryptischen Einverleibung, Spiegelbild einer Gesellschaft und ihrer ästhetischen Errungenschaften und menschlichen Abgründe.
[wina - 11–2021]

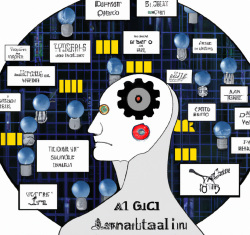
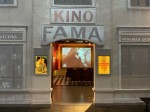


 WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 5_2017 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 5_2017 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK