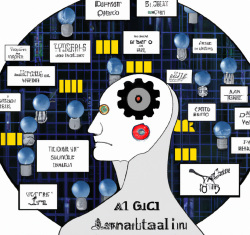WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 03_2023 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
„AI has become a mechanism for influencing the imaginations of billions.“
Lev Manovich (AI-Aesthetics, 2018)
KI ist omnipräsent. Selbst dort, wo wir sie nicht wahrnehmen, prägt sie unser tägliches Leben. Wir profitieren von im Hintergrund ablaufenden Automationsprozessen und werden mit jedem neuen Schritt durch unseren digitalen Alltag geleitet, wie auch manipuliert. Das Gros von KI-basierten Systemen begleitet unsere (Online-)Interaktionen. Die KI bleibt dabei allerdings wie selbstverständlich im Verborgenen. Wir nehmen sie, nicht zuletzt durch die Mimesis des Humanen, schlicht nicht mehr wahr, vergessen sie, begrüßen die technologische Faszination, verdrängen sich manifestierende Kontrollmechanismen und möglichen Missbrauch.
Die KI bleibt dabei allerdings wie selbstverständlich im Verborgenen. Wir nehmen sie, nicht zuletzt durch die Mimesis des Humanen, schlicht nicht mehr wahr, vergessen sie, begrüßen die technologische Faszination, verdrängen sich manifestierende Kontrollmechanismen und möglichen Missbrauch.
Seit Ende letzten Jahres, mit dem Erscheinen neuer KI- Tools, erfährt die Diskussion um die Anwendung und Aus- wirkungen von Artificial Intelligence freilich vermehrt mediale Aufmerksamkeit. Sprachbasierte Bildgenerierung (u.a. DALL-E2), Dialog-Tools aka Chatbots (ChatGPT) und Stimmsimulationsprogramme (VALL-E) haben Einzug in die Berichterstattung gehalten. Einmal mehr führt das Wettrennen der hinter der Technologie stehenden dominanten Tech-Giganten Microsoft vs. Google zu aufmerksamkeitsgenerierenden Headlines.
Dass wir es mit einer – in ihrer Unabsehbarkeit noch nicht dagewesenen – gewaltigen Revolution der digitalen Welt zu tun haben, gerät dabei oftmals ins Hintertreffen. Die Auswirkungen der rasanten multimedialen KI-Wirkkraft auf das Individuum, seine Wahrnehmung, auf Gesellschaften, Länder, Weltgegenden und den gesamten Globus liegen jenseits unserer menschlichen Vorstellungskraft. Wir betreten soeben unbekanntes Terrain, sind alle Testpersonen in einem überdimensionalen Feldexperiment der radikalen Entfesselung von Content. Bild, Text und Ton: Nichts ist nunmehr Beleg für tatsächlich Gewesenes. Alles ist allen potenziell möglich. Und überall Stopfen künstliche Artefakte die klaffenden Löcher in der Matrix.
Haben wir anfangs, im November letzten Jahres noch amüsiert reagiert, als DALL-E2 uns auf unterschiedliche Prompts (Suchbegriffe, Beschreibungen) Bilder von Menschen mit sechs Fingern (als gäbe es eine verborgene Verbindung zu mittelalterlichen Symboliken) und grotesk verzerrten Gesichtern lieferte, einmal mehr die Bias hinsichtlich Gender und Race („couple standing at the beach“) reproduzierte oder am sauberen Rendering von Objekten oder Räumen scheiterte, so hat sich rasch abgezeichnet, dass hier eine massive Lawine auf uns zurollt. Sie droht unser Wahrnehmungsvermögen unter Pixelmassen zu verschütten.
Haben Schriftsteller:innen und Literaturwissenschafter:innen zuletzt die Potenziale jener neuen Textprogramme ausgelotet – und unter anderem – Suaden à la Thomas Bernhard generiert, sich buchstäblich amüsiert und ChatGPT glaubhaft unsinnige – wie symbolhaft in einer (Post-)Trump- Medienwelt – Fantasieantworten ausspucken zu lassen, es DJs wie David Guetta spaßig gefunden, Eminems künstlich generierte Stimme in seine Live-Show einzubauen, so drängten folgende Fragen in den letzten Wochen akut in den Vordergrund: Was trägt die AI zur Kultur bei, wie verändert sie diese? Überwiegen die Pros oder die Cons? Wird KI den Menschen als Kreierenden, Schaffenden in Medien, Wissenschaft, Mode, Fotografie, Literatur, Film, Architektur etc. ersetzen? – Der russisch-amerikanische Medientheoretiker Lev Manovich schlägt vor, die AI selbst dazu zu befragen.
„If all creative and knowledge work the domain of AI, what will be left for humans? What will be the purpose of our existency?“ Der Prompt führt zu einer Vielzahl an Abbildungen, die als Ausdruck eines ästhetisch-symbolischen wie auch sinnbefreiten Desasters gelesen werden können: Verzerrte Stockfotografie trifft auf abgenutzte Diversitätsdarstellungen (Illustrationen von Menschen mit unterschiedlichem kulturellem und ethnischem Background; Tropenhelm inklusive), und auch das obligate menschliche Hirn, eine naive Roboterzeichnung und jede Menge Fantasiesprech-Bubbles fehlen in diesen Wimmelbildern nicht.
Werden wir die Welt zunehmend nur mehr in Kategorien wahrnehmen, in Mustern, die die KI uns vorgibt, die sie mit jedem Klick in unserem Bewusstsein vorantreibt? Wie können wir dem etwas entgegensetzen, um die Wahrnehmung von Systemzusammenhängen, von Komplexität und Interdependenzen zu fördern?
Es geht aktuell – und das mehr denn je – um das Ausprägen von bewussten Haltungen, die kritisch-kreative, mit- unter subversive Nutzung neuer Technologien, das Gegen- den-Datenstrom-Schwimmen (ein Agieren entgegen der offenkundigen KI-Anwendungslogiken) und ein Denken jenseits von Gegensätzen und Schubladen, um kulturellen Phänomenen sowie der Brisanz aktueller Krisen – gerade auch mittels neuer technologischen Möglichkeiten – verändert begegnen zu können.
[wina - 03–2023]